Neues zum allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 I GG)? - In Anlehnung an: BVerfG, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12
von AlexDeja · am Sa, 07/02/2015 - 13:28 · Aktuelles und Gemischtes
In dem oben genannten Urteil setzt sich das BVerfG vorrangig mit den Regelungen der §§ 13a, 13 b (ErbStG) auseinander. Bei der Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit prüft das BverfG diese durchweg an Art. 3 I GG.
Für den Studenten geläufig, ist die abgestufte Prüfungsdichte des BVerfG, die von einer bloßen Willkürkontrolle, bis zu einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung reicht. Das BVerfG legt schön dar, dass auch bereits die Bestimmung der richtigen Prüfungsdichte, eine von Wertung durchzogene Entscheidung ist.
Maßgebliche Kriterien sind insoweit:
-
1. Freiheitsrechtliche Relevanz der Ungleichbehandlung2. Nähe zu den Kriterien des Art. 3 III GG3. Verfügbarkeit der Differenzierungsmerkmale für den Einzelen
Der letztere Punkt wird auch Unterscheidung zwischen der Anknüpfung an Sachverhalten oder an persönlichen Merkmalen begriffen. Mit anderen Worten: Je weniger der Einzelne das Differenzierungskriterium beeinflussen kann, desto eher ist eine strengere Prüfung geboten.
Hinzu kommt in der Entscheidung ein weiterer Aspekt: Die Intensität der Ungleichbehandlung. Das BVerfG hat in dem Kontext des Erbschaftssteuergesetzes die enormen Verwerfungen angeführt, die dadurch entstehen, dass bestimmte Vermögen in ihrem Wert zu 85 oder 100 % steuerfrei gestellt sind, während andere Vermögen mit einem Steuersatz von 50 % besteuert werden. Das BVerfG hat auch in dieser Hinsicht nichts anderes getan, als zwei mögliche Sachverhalte anhand des Differnezierungsgrundes zu vergleichen. Während jedoch bei den oben genannten Merkmalen überwiegend der Differenzierungsgrund selbst im Mittelpunkt der Betrachtung steht, sind nun die Auswirkungen der Differenzierung zu betrachten.
Um diese Auswirkungen zu ermitteln, braucht man Mess- und Vergleichsgrößen, die sich aus einer Gesamtschau des Sachverhalten sowie der allgemeinen Begleitumstände ergeben. Im oben genannten Urteil zieht das BVerfG als Rahmen den Wert der verschiedenen Vermögensgegenstände und die möglichen prozentualen Abweichungen bei der Festsetzung des Steuersatzes heran. Abstrahiert betrachtet, ist dies eine Wertungsentscheidung (wie die Prüfung der Verhältnismäßigkeit auch), die sich nachvollziehbar begründen lassen muss.
Weitere Anmerkung:
Das BVerfG zieht zur Unterstützung seiner Prüfungsintensität gerne auch mehrere Kriterien heran, was nicht bedeutet, dass zwingend mehrere vorliegen müssen. Letztendlich ist die Frage nach der "richtigen" Prüfungsintensität eine der eigentlichen Püfung des Art. 3 II GG vorgelagerte Wertungsfrage, dessen Ergebnis sich nachvollziehbar begründen lassen muss. Als Hilfe kann und muss das GG selber dienen. Die Nähe zu Freiheitsrechten, die Nähe zu Art. 3 III sowie die Verfügbarkeit der Differenzierungsmerkmale für den Einzelnen sind Kriterien, die sich aus der Auslegung ergeben. Ebenso auch das Merkmal der Intensität der Maßnahme, denn je intensiver eine Ungleichbehandlung ist, desto weiter entfernt sie sich vom Leitbild des Verfassungsgesetzgebers, weil die Ungleichbehandlung dadurch stärker wiegt und die Adressaten stärker betroffen sind. Eine reine Willkürkontrolle scheint da nicht mehr angemessen zu sein. Im Folgenden muss das BverfG ebenso wie der Prüfling einen nachvollziehbaren Maßstab für den Grad der Intensität der Differenzierung bilden.
Hol Dir den gesamten Stoff vom ersten Semester bis zum zweiten Examen kostenlos für drei Tage auf Jura Online!
Das könnte Dich auch interessieren
Hausarbeiten erfolgreich schreiben:
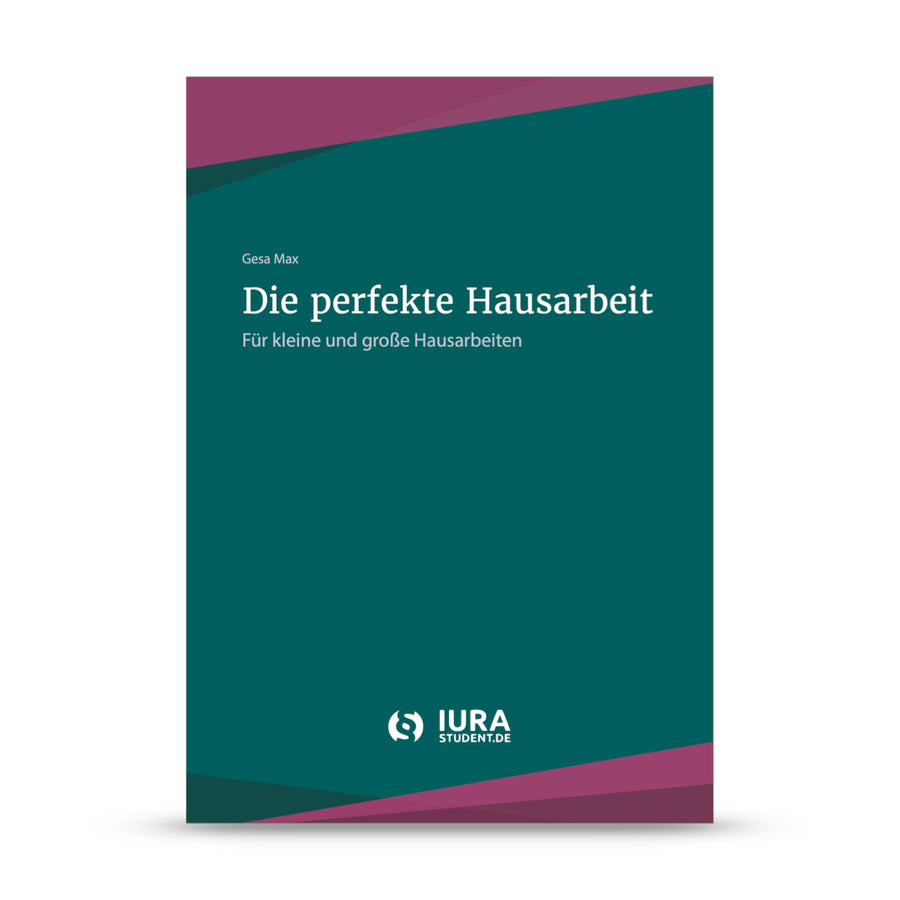 Zum eBook Download
Zum eBook Download
Klausuren erfolgreich schreiben:
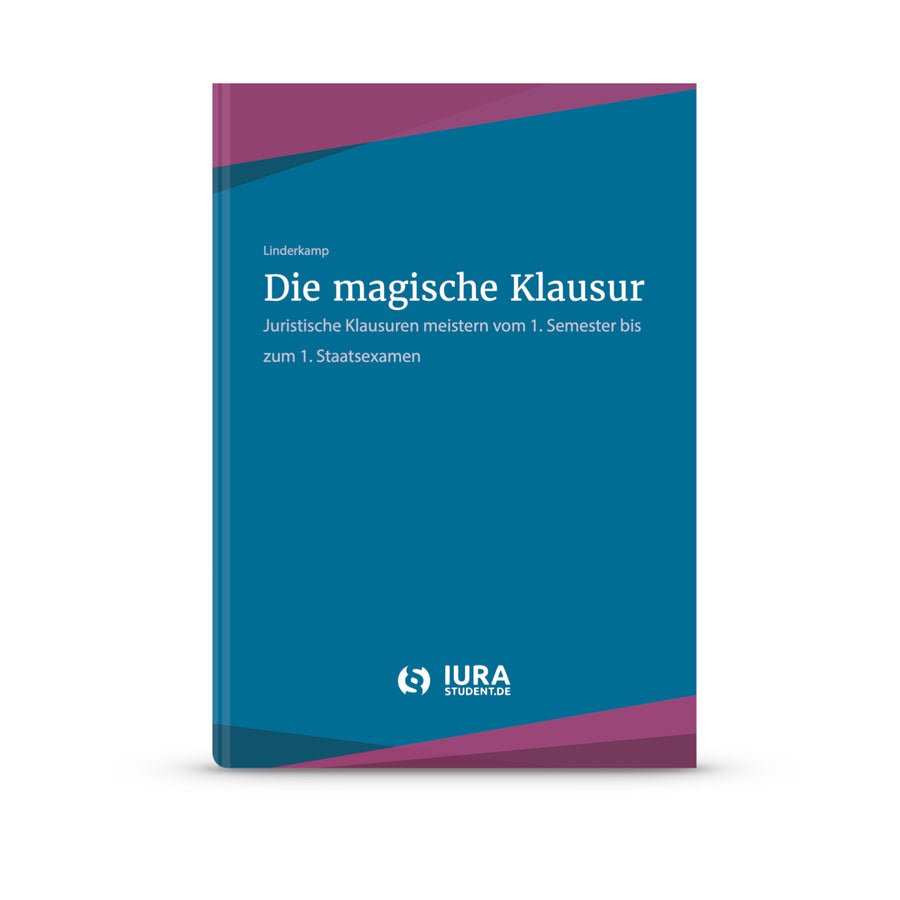 Zum eBook Download
Zum eBook Download
3.000 Euro Stipendium
Zur AnmeldungEvent-Kalender
Aktuelle Events für Jurastudenten und Referendare in Deutschland!


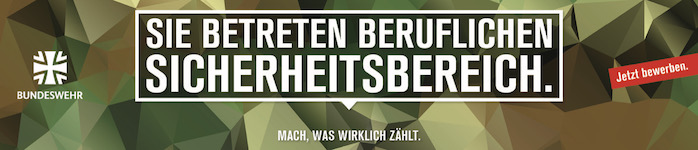



Und Deine Meinung zu »Neues zum allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 I GG)? - In Anlehnung an: BVerfG, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12«